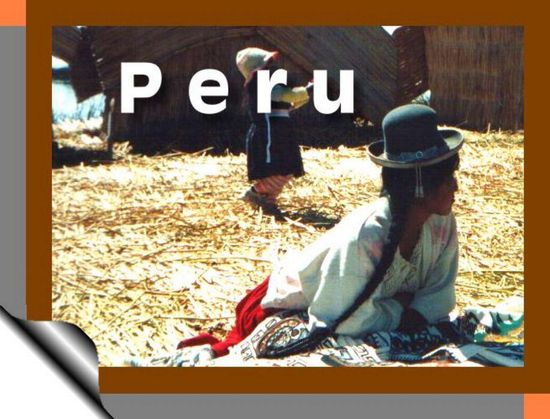Neue Wege - eine Reportage über Südamerika
Titicacasee
Es ist Mai, der Herbst vollendet auch hier sein Werk. Kälte und Regen machen aus der kleinen Hafenstadt Puno einen schlammigen ungastlichen Ort. Es ist 18 Uhr und schon dunkel, ich sitze wie üblich in einer Kneipe. Draußen regnet es bindfadenartig. Zum Glück schiebt niemand mir die Schuld in die Schuhe, ich bin hier noch sehr unbekannt. Die Gruppe Israelis am Ecktisch ist mir allerdings nicht unbekannt, fuhren sie nicht schon in einem der anderen Jeeps den Uyunitrip mit mir? Sie sind nicht zu überhören, einer will den anderen mit einer lauten lustigen Geschichte übertrumpfen.
Im Kamin knistert das offene Feuer. Es gibt heißen Rotwein. Für mich ein Gläschen gratis, weil ich auf Empfehlung meiner Wirtin hier gelandet bin. An den anderen Tischen sitzen ausschließlich Turisten, dafür habe ich mittlerweile einen Blick. Ein Liebespaar, in den besten Jahren wie man sagen würde, unterhält sich leise, begleitet von vielen spontanen Quieckern, nebenbei spielt der Herr, dessen Bart schon einen grauen Schimmer hat, an der brennenden Kerze herum.
Er drückt den weichen Wachs zusammen, pult ihn dann als feste Masse von seinen Fingerspitzen und krümelt ihn zurück in die Kerze. Ein Bild, das ich von zu Hause kenne. Die arme Kerze, denke ich, soll er doch lieber an der Frau herumspielen, die wartet nur darauf. Blöde Gedanken, die ich mal wieder habe. Gefallen mir selber nicht. Ich bin doch nur neidisch, weil ich Abend für Abend alleine in einer Kneipe hocke.
Da werde ich plötzlich auf eine tolle Art wieder aufgemuntert. Eine Gruppe junger Männer in Ponchos und mit Instrumenten beladen betritt den Raum. Sie stellen sich auf und beginnen zu spielen. Das ist genau das, was mir jetzt gefehlt hat, kommt es mir in den Sinn. Die Männer sind noch sehr jung, haben eine gewisse Professionalität. Einer sieht meinem Bruder ähnlich, ha, wieder jemand für meine Ähnlichkeitsliste. Die Panflöten erzeugen Töne, die mein Herz mitschwingen lassen. Der Rhythmus der Trommeln ist dazu bestimmt, diese Schwingungen nicht ausklingen zu lassen. Wie immer schafft es die Musik, mich in gute Laune zu versetzen. Ich höre einfach zu und genieße, hebe mir meine Gedanken für später auf, wenn ich wieder alleine bin.
Die Jungs geben ihr Bestes, es scheint, als toben sie wie ein Orkan auf dem Titicacasee durch die Kneipe.
Ich habe heute einen solchen Sturm auf dem See ohne kotzen überstanden, mir scheint als würden sie nur für mich spielen. Sie haben erkannt, welche Zuhörerin ich sein kann.
Dem Liebespaar ist es doch egal ob sie Musik hören oder nicht, die sind mit ihren Gedanken schon weit voraus. Den Israelis ist es vielleicht sogar unangenehm, jetzt müssen sie noch lauter reden, um gehört zu werden. Doch auch einige von ihnen sind ruhiger geworden, bewegen sich zum Rhythmus der Musik, obwohl sie ganz andere musikalische Traditionen in sich tragen.
Die Gruppe ist weitergezogen. Mir war der Auftritt 10 Soles wert, ungefähr 5,50 Mark, genauso viel wie meine Übernachtung im Hotel.
Obwohl ich schon länger in der Kneipe sitze und festen Boden unter den Füßen habe, kommt es mir so vor als schwanke ich auf einem Boot hin und her.
Kein Wunder, vier Stunden hat die Überfahrt heute auf dem Titicacasee von Amantani nach Puno gedauert. Noch immer fühle ich mich wie auf dem Wasser und deshalb natürlich nicht ganz so wohl.
Dagegen hilft natürlich noch ein Becher dieses köstlichen heißen Rotweins und vielleicht ein paar Notizen in meinem Buch? Schließlich darf ich nicht vergessen, was ich auf den schwimmenden Inseln, Amantani und Taquile gesehen und erlebt habe.
Gestern begann mein Tag schon ziemlich zeitig. 6.30 saß ich frisch geduscht am Frühstückstisch meines Hotels. Hier bin ich gelandet, weil mich die Besitzerin beim Aussteigen aus dem Bus aus La Paz gleich ansprach und mir ihr Hotel empfahl. Frauen gegenüber muss man in Südamerika nicht skeptisch sein. Da habe ich nicht lange überlegt!
Das Frühstück war üppig, starker Kaffee, Orangensaft, warme Brötchen, was will man mehr. Es gab sogar noch ein Omelett. Der Preis war nicht in der Übernachtung enthalten, aber trotzdem für 2 Mark erschwinglich. Musste ich nicht auch etwas gestärkt am Morgen sein? Mit einem Kleinbus wurde ich zum Hafen gefahren. Hier traf sich ein bunt zusammengewürfelter Turihaufen, um zwei Tage gemeinsam Land und Leute des Titicacasees kennenzulernen. Ich war unheimlich aufgeregt. Endlich war ich da, wovon ich schon als ganz junger Mensch geträumt hatte. auf dem Titicacasee.
Ich habe dieses Wort immer geliebt, weil es eine magische, märchenhafte Anziehungskraft auf mich ausübte. Es verband die Vorstellung von nie gesehenen Naturschönheiten und dem Inkavolk - beides wurde in meiner Schulzeit mystifiziert als etwas Vergangenes. Dass es aber diese Natur immer noch gibt und in ihrem Raum Chechua- und Aymara-Indios, mehr als 50 % der Bevölkerung Perus und Boliviens, leben, war nicht so wichtig zu lernen, denn es gehörte ja nicht zum sozialistischen Ausland.
Doch gleich zu Beginn der Reise musste ich mir von unserem hervorragenden Reisebegleiter, der perfekt englisch und spanisch sprach, erklären lassen, das dieser See in der Sprache der hier lebenden Chechua-Indianer "Titichacha heißt".
Dabei hatte ich gelesen, dass das Wort aus der Sprache der Aymara-Indianer stammt und ursprünglich die heutige Sonneninsel auf dem See auf bolivianischem Gebiet so hieß. Gedeutet wird der Name aus zwei Wörtern, "titi" bezeichnet eine Wildkatze und "kak" bedeutet Felsen - Tigerfelsen.
Der Reisebegleiter war ein echter Chechua, vielleicht hat er uns die Version der Aymara, seiner Nachbarn auf dem See, nur vorenthalten, weil er von seinem eigenen Volk erzählte.
Auf dem Wasser spiegelte sich die Sonne, sie schaute vom wolkenlosen Himmel auf ihren See, aus dem sie geboren wurde. Hier ist der Platz, an dem der Schöpfergott Viracocha Sonne, Mond und die Urbilder der Menschen schuf. Hier stieg der Sonnengott zum Himmel empor und sein Sprung war so gewaltig, dass er einen Fußabdruck in dem Felsgestein der Sonneninsel hinterließ.
Meine Gedanken werden irdischer, ich schaue in das Wasser. Der Titicacasee ist durchsichtig wie Glas, der Grund zum Greifen nahe und mit dunkelgrünen Algen bewachsen. Wenn das Motorboot langsam darüber fährt, sieht es aus, als würden die Wellen zu einem Seemannslied schunkeln. Wir steuern auf die erste schwimmende Insel zu. Goldgelb leuchtet sie bei unserer Ankunft. Die Sonne strahlt auf die getrockneten Binsen, welche die Urus, die Bewohner dieser Inseln, als Boden übereinanderschichten. Man läuft darauf wie auf einem fliegenden Teppich. Auf der Insel, die gerade mal 30 Quadratmeter groß ist, stehen 8 Hütten mit spitzen Dächern, alles ist aus diesen Binsen gebaut die in windgeschützten Lagunen wachsen. Im Halbkreis sitzen die Frauen auf dem Boden, haben ihre buntbestickten weiten Röcke wie kleine Tische um sich gelegt und bieten ausdauernd und energisch ihre Handarbeiten an. Alle haben das gleiche Angebot und ich bezweifle, dass die glückbringenden Ketten wirklich selbstgemacht sind.
Die Wandteppiche von unter-schiedlicher Größe sind wunderschön, Farben wie Pink und Türkis oder Cremefarben verheißen mit ihren Göttersymbolen das Beste für den Käufer. Aber kaufen möchte ich nichts. Die Kinder auf der Insel toben herum, ein Mädchen, vielleicht eineinhalb Jahre alt, geht zwischen den langen Beinen der Touristenmenge hindurch, stellt sich in die Mitte und streckt ihre kleine Hand vor. Eine abgeguckte Geste, was kann dieses Kind schon vom Betteln wissen. Es sieht sehr gesund aus, genau wie die Mütter und man demonstriert uns auch, wie die Menschen hier sogar das Mark der Schilfpflanze essen. Was nicht heißt, dass sie sich ausschließlich davon ernähren. Es gibt auch Hühner und Schweine, Kartoffeln und Bohnen auf den Inseln. Sie fangen Fische mit Netzen oder Reusen, die sie auch aus diesen Binsen herstellen.
Diese Menschen, selbst von den Bewohnern am Rande des Titicacasees als seltsam eingestuft, bezeichnet sich als "Volk des Sees". Sie hielten sich für besondere Menschen und glaubten, sie hätten schwarzes Blut. Dieses würde sie vor dem Ertrinken und Erfrieren schützen.
Sie lebten Urzeiten mit dem See in einer Symbiose. Uns werden sie wie ein "lebendes Völkerkundemuseum" präsentiert. Täglich kommen Scharen von hellhäutigen Menschen hier her, bestaunen diese einfache Lebensweise, sehen die traurigen Gesichter der Frauen und denken sich ihren Teil. Was denken sich diese Urus beim Anblick dieser Foto- und Videokamera tragenden großen Menschen, die so gerne ihre schmutzigen, barfüßigen Kinder fotografieren? Sie geben ihnen was sie wollen, ein farbenprächtiges Bild für das Album zu Hause und verlangen dafür, dass man ihre Ware abkauft.
Ich wäre gern als Mäuschen auf der Insel geblieben. Wir sind noch keine zehn Meter entfernt, als ich ein fröhliches Stimmengewirr von dort höre. Die Frauen lachen - über uns, die einfältigen Turisten? Über das Essen, das bald fertig ist? Man konnte es bereits riechen, sehr verführerisch.
Nach dreieinhalb Stunden Bootsfahrt Ankunft auf der Insel Amantani, die ich von einer Fernsehreportage her kannte und unbedingt sehen wollte. Genau wie beschrieben, wurden wir an der Anlegestelle für Schiffe, die vor drei Jahren von den Inselbewohnern gemeinsam erneuert wurde, abgeholt. Immer zwei Reisende wurden einer Familie zugeteilt. Es gab schon vorbereitete Listen und so ging es zügig voran mit der Aufteilung. Ich wurde mit dem 21 jährigen deutschen Jan zusammen einquartiert. Zu den Häusern mussten wir steil emporklettern. Die Frauen und Mädchen, die uns abgeholt hatten, hüpften in ihren Sandalen leichten Schrittes vor uns her.
Die meisten Gäste hatten hohe Wanderschuhe an, sie kamen nur mühselig voran. Die Höhe tat noch ihren Teil , wir befanden uns immerhin 3.900 Meter hoch, fast alle Turis japsten. Langsam wurden wir weniger, immer zwei verschwanden hinter hüfthohen Mauern aus großen Steinen. Bäume und Sträucher verdeckten zum Teil die Häuser. Wir wohnten gleich neben einem großen Fußballfeld.
Es hatte zwei mannshohe Tore und ein paar kleine barfüßige Jungs spielten. Die Hausherrin bat uns in den Patio, zeigte uns unsere kleine Schlafhütte. Ein blassblau gestrichenes Häuschen mit zwei Fenstern und einer großen Tür, die offen stand. Der Raum war dunkel, als Schmuck hing an der Wand die Genehmigung des Staates Peru, dass die Familie Soundso Leute beherbergen darf. Rechts und links gab es breite Bettgestelle mit Decken, in der Mitte einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Auf dem Tisch standen einige halbabgebrannte Kerzen.
Auf dem Hof lagen Früchte zum Trocknen, rötlich und klein wie Nüsse. Sie verdeckten einen Teil eines wunderschönen Steinmosaiks, das aus diesem kleinen Hof ein Stück "Präkolumbische Hochkultur" machte. Es gab ein großes Wohnhaus, zu dessen Eingang eine schmale Holztreppe führte und auf der anderen Seite stand ein kleineres Wohnhaus. Hier lebten mehrere Generationen zusammen.
Leider wurden wir nicht in die Häuser gebeten und ich traute mich nicht diese schüchternen Menschen zu fragen. Wir bekamen einen leckeren Mate de Coca von unserer Dona Maria serviert. Dann kam sie mit einer Suppe aus Kartoffeln, Quinoa und Reis. Es schmeckte uns vorzüglich, Nach dem Essen hatten sich alle Turisten für den Aufstieg auf den Pacha Mama verabredet.
Unser Reisebegleiter stieg mit uns hinauf, aber er war nun nicht mehr die Chechua-Attraktion, sondern die Jungs, die uns mit ihren Blas- und Schlaginstrumenten bis zum Gipfel begleiteten.
Wir liefen vorbei an abgeernteten Kartoffel- und Weizenfeldern, alle vor ewigen Zeiten terrassenförmig angelegt. Tiere sah ich keine. Die Wege waren mit Steinen gesäumt, die wie eine kleine Mauer am Rand aufgestapelt waren und das schon vor vielen hundert Jahren. Um auf den Pacha Mama, den Berg der Mutter Erde zu gelangen, mussten wir durch ein Steintor gehen. Dahinter saßen vielleicht 12jährige Mädchen mit ihren kleinen Geschwistern und wollten uns Getränke und Süßigkeiten verkaufen. Sie saßen umsonst, wir hatten unsere eigenen Wasserflaschen dabei. Trotzdem blieben die Mädchen sitzen, spielten zusammen und lachten laut und herzhaft. Nun wurde es endlich Zeit, mich von der Gruppe zu trennen, ununterbrochen erzählte uns Paulo interessante Dinge über die Insel, aber ich konnte kein Wort mehr verstehen, sondern wollte mich lieber wieder auf das verlassen, was ich sah.
Gegenüber dem Pacha Mama befindet sich der Pacha Papa, der Vater der Erde. Nach einer Legende leben diese beiden Berge in ewigem Frieden zusammen.
18 Uhr wurde es innerhalb von 10 Minuten dunkel. Die Sonne versank knallrot wie auf einer Kitschpostkarte hinter den Bergen des Festlandes und ihr ganzes letztes Licht fiel gebündelt als roter Streifen auf den See. Der See war ganz ruhig, scheinbar schon lange schlafen gegangen und auch über ihm, der den ganzen Tag eine angenehme blaugrüne Farbe wiedergegeben hat, legte sich in minutenschnelle der schwarze Mantel der Nacht. Es gab nur wenige schwache Lichter am Horizont, die von Ansiedlungen zeugten. Auf unserer Insel gab es kein Licht, jedenfalls kein elektrisches. In stockdunkler Nacht torkelten wir zurück ins Dorf, noch trunken von diesem Schauspiel der Natur. Einige machten sich Sorgen, wie sie wohl jetzt ihr Haus wiederfinden sollten. Aber am Sportplatz warteten schon Familienmitglieder, um ihre Gäste zu empfangen. Manche kannten sogar schon die Namen und ich hörte nach Veronika rufen, einem Mädchen aus Frankreich.
Aber der Abend war noch lange nicht zu Ende. Es gab wieder Tee und Reis mit gebratenen Eiern. Nach diesem üppigen Mal erwartete uns eine Art Disco im Gemeinschaftsraum des Dorfes. Die Frauen standen in dunkle Kleider gehüllt, mit verschränkten Armen und beobachteten das lustige Treiben ihrer Kinder. Alle unverheirateten jungen Mädchen hatten ihre schönen Sachen angezogen, einen weiten roten Rock, weiße Bluse und ein besticktes Tuch darüber.
Die Mädchen holten sich die Fremden, gleich ob Frau oder Mann und tanzten, an den Händen angefasst, eine Art Hänsel-und-Gretel-Drehen wie ich es aus meiner Kindergartenzeit kannte. Jedes Mädchen tanzte trotzdem anders.
Eine hatte mehr Schwung in den Armen und obwohl sie viel kleiner war als ich, drehte sie mich herum und ich machte eine Pirouette. Die Übertücher verrutschten natürlich bei dieser wilden Dreherei, aber mit einem schnellen Griff waren sie wieder an Ort und Stelle. An den Füßen trugen sie die braunen Sandalen, die sie auch am Tage anhatten und immer noch brauchten sie keine Strümpfe. Ein starker Kontrast zu den großen klobigen Wanderschuhen der Gäste.
Durch das Tanzen wurde mir sehr warm, nicht unwichtig bei Nachttemperaturen um die Null Grad.
Das es auch durstig macht, wissen die geschäftstüchtigen Frauen, denn sie verkauften uns Flaschenbier zu einem stolzen Preis.
Die Musik machten die Jungen des Dorfes. An den kurzen Seiten des Raumes standen sie, erhöht auf Bänken und abwechselnd kam die Musik von rechts oder links. So konnten sie drei Stunden durchspielen ohne Pause zu machen, denn sie wechselten sich ständig ab. Der Jüngste in der einen Gruppe war höchstens 8 Jahre. Er schlug die große Trommel, die Huancara. Das Hauptinstrument aber ist die Panflöte, hier heißt sie Sicu. Vier verschiedene Größen sorgen für unterschiedliche Töne. Viele Spieler schaffen es, aus einzelnen Tonfolgen eine fortlaufende Melodie zu erzeugen, weil jeder Spieler das Thema seines Vorgängers aufgreift und weiterspielt. Wie theatralisch es dabei zugehen kann, erleben wir bei einem Jungen, der groß und schlaksig seinen ganzen Oberkörper beim Spielen zum Einsatz bringt und von der Bank fällt. Eine schmale Bank wie aus dem Sportunterricht. Diese Bänke standen rings an den Wänden und dienten den Discobesuchern auch als Sitzplätze. Der Fußboden, auf dem so intensiv getanzt wurde, war aus Beton. Das Licht spendeten einige Öllampen, denn um diese Zeit war der Strom auf der Insel bereits abgestellt. Die Einwohner Amantanis kaufen pro Tag für 3 Stunden Strom und sind damit sehr zufrieden. Schließlich kamen sie bis vor 4 Jahren noch gänzlich ohne Generatoren, Masten, Glühbirnen aus.
Die Frauen beobachteten die ganze Zeit das Geschehen, ohne auch nur ein einziges Gespräch miteinander zu führen, etwas zu trinken oder zu rauchen. Der Abend gehörte der Jugend. Als Jan und ich schlafen gehen wollten, wussten wir im ersten Moment nicht, welche von den Frauen wir ansprechen sollten, damit sie uns begleitet. Aber kaum gingen wir in ihre Richtung, kam Dona Maria auf uns zu und brachte uns nach Hause.
Sie hatte uns also die ganze Zeit im Auge behalten. Bevor wir schlafen konnten, wollte sie uns noch einige selbstgemachte Handarbeiten verkaufen. Zum Andenken an diese Insel kaufte ich ein geknüpftes Armband mit der Aufschrift "Amantani". Dass ich selbst tolle Armbänder knüpfen konnte und auch bei mir hatte, verriet ich ihr nicht.
Am nächsten Morgen sollten wir 6 Uhr aufstehen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Alles war zum Wecken vorbereitet, aber, ja was wohl? Es goss aus Kannen! Wir blieben liegen. Frühstückten erst um 8 Uhr Mate de Coca und Reis und Kartoffel mit warmen Brötchen.
Frisches kaltes Waschwasser stand vor unserer Tür, vielleicht war es auch von dem Regen so frisch, aber es machte munter. Weißer Schaum vom Zähneputzen klatschte auf das Steinmosaik, doch der Regen spülte es gleich weg. Ich aber wollte nicht weg.
Ein Mädchen unserer Familie brachte uns hinunter zum Steg. Ich fragte sie, ob sie auch gestern Abend beim Tanzen war. Sie nickte eifrig, aber wiedererkannt habe ich sie nicht. Sie sah jetzt wie ein kleines Aschenputtel aus, eingemummt in einem dunklen Umhang, ihre Füße in den kaputten Sandalen flogen über die Steine den Weg nach unter. Wir hatten große Schwierigkeiten hinterherzukommen. Rechzeitig waren alle versammelt, unser Boot war voll, alle Inselbewohner winkten uns beim Abschied lange nach.
Wir schifften rüber nach Taquile, die Nachbarinsel. Die Fahrt ging diesmal über brechende Wellen. Viele von uns taten es den Wellen gleich. Ich saß eine Stunde bewegungslos eng an meinen Nachbarn gequetscht und starrte vor mich hin. Nur nicht bewegen!
Taquile ist ähnlich wie Amantani. Viel Vergangenheit, Ruhe, Berge, es riecht nach Kräutern, Eukalyptus. Ein menschenleerer Marktplatz erwartete uns. Ich sah keine strickenden Männer wie voraus- gesagt, nur zwei geöffnete aber leere Kneipen. Mittagshitze. Ab und zu neugierige Kinder, die Armbänder verkaufen wollten. Ich zeigte ihnen mein letztes Exemplar und sie schauten neidisch, sagten, dass es schön aussieht und wir tauschten sie aus. Das Lachen der Kinder und die Freude über den kleinen Augenblick Leben, die sie zeigten, machte mich sehr glücklich. Auf diesem Markplatz haben die Bewohner ein Schild aufgestellt, dass in allen vier Himmelsrichtungen die Kilometerzahlen nach Moskau, New York, Peking, Feuerland, Australien zeigt. Die Welt mit ihren sensationellen Schauplätzen wird hier sozusagen als Richtung empfohlen. Oder man weiß genau, wie weit weg man sich von der eigenen Heimat befindet. Das mag bei manchen Heimweh hervorrufen. Ich fühlte mich im Moment gerade hier auf dieser kleinen Insel, neben dem 8 Meter hohen Glockenturm aus Stein und dem Blick auf den wieder ruhigen Titicacasee so heimisch, wie ich es nicht beschreiben kann.
Einen gegrillten Titicacaseefisch gab es zum Mittag in einer einheimischen Kneipe abseits des Marktplatzes. Auf dieser Insel bewirtschaften die Familien abwechselnd die Gaststätten, damit jeder an dem Verdienst beteiligt ist. Genauso, wie jedes Jahr aus einer anderen Familie ein männliches Mitglied zum Bürgermeister bestimmt wird. Angesteckt von zwei Deutschen essen alle ihren Salat nicht. Ach so, das Gemüse soll oft ungewaschen sein und deshalb gut für eine anschließende Magen- und Darmgrippe. Dieser Gefahr sehe ich stolz ins Auge, ich verzichte doch nicht auf die Vitamine. Was für ein ansteckender Dreck kann schon hier auf dieser Insel sein?
Auf der Rückfahrt knüpfte ich an einem neuen Armband und eine israelische Frau setzte sich neben mich und wollte es lernen. Ich gab ihr Fäden und eine Sicherheitsnadel, zeigte ihr die einfachsten Knoten. Aber sie wollte sich gleich an schwere Muster heranmachen. Erstaunlich lange hat sie sich damit beschäftigt, während alle anderen schweigend oder schlafend auf dem glitzernden See das Ende dieses Ausfluges erlebten.
Der Tag hatte mit Regen begonnen, verwöhnte mich dann allerdings mit viel Sonne und Wind, aber er beschloss auch, ihn mit bisschen Regen und Kälte aufhören zu lassen. Macht mir nichts aus, ich sitze ja in einer warmen Kneipe und habe eine wunderschöne Musik gehört, die auf dem Titicacasee und dem Hochland der Anden zu Hause ist. Was will ich mehr?
| Aufbruch: | 18.10.1999 |
| Dauer: | 9 Monate |
| Heimkehr: | 06.07.2000 |
Brasilien
Argentinien
Peru